Die Welt von Christian Hofmann von Hofmannswaldau: Eine barocke Reflexion über Vergänglichkeit und Erlösung
Das Gedicht "Die... Mehr anzeigen
Bipolare welt und deutschland nach 1953
Europa und globalisierung
Deutschland zwischen demokratie und diktatur
Herausbildung moderner strukturen in gesellschaft und staat
Demokratie und freiheit
Das 20. jahrhundert
Imperialismus und erster weltkrieg
Das geteilte deutschland und die wiedervereinigung
Europa und die welt
Friedensschlüsse und ordnungen des friedens in der moderne
Frühe neuzeit
Der mensch und seine geschichte
Die moderne industriegesellschaft zwischen fortschritt und krise
Akteure internationaler politik in politischer perspektive
Großreiche
Alle Themen
Deutsch
17. Sept. 2025
10.176
2 Seiten
Jule :) @lernen.leichtgemacht
Die Welt von Christian Hofmann von Hofmannswaldau: Eine barocke Reflexion über Vergänglichkeit und Erlösung
Das Gedicht "Die... Mehr anzeigen

Trotz der vorherrschenden negativen Sichtweise auf das irdische Leben enthält das Gedicht auch einen Aufruf zur geistigen Erweiterung. Das lyrische Ich fordert die Seele auf, über die Grenzen der bekannten Welt hinauszublicken
Quote "Komm Seele, komm und lerne weiter schauen / Als sich der Zirkel dieser Welt erstreckt"
Diese Aufforderung steht im Kontrast zum vorherigen Jambus und wird dadurch besonders hervorgehoben. Sie suggeriert, dass es jenseits der irdischen Beschränkungen eine tiefere Erkenntnis oder Erlösung geben könnte.
Das Gedicht gipfelt in der Vorstellung des Todes als Befreiung von den Lasten des Lebens. Der Hafen der Ewigkeit wird als Metapher für das Leben nach dem Tod verwendet, wobei die Schönheit erst in der Unendlichkeit vollständig erkannt werden kann.
Highlight Die Darstellung des Todes als Erlösung ist ein typisches Motiv der Barockliteratur und spiegelt die Vanitas-Thematik wider.
Das gesamte Gedicht kann als eine Antithese betrachtet werden, die die irdische Welt dem menschlichen Streben nach Transzendenz gegenüberstellt. Es reflektiert die Orientierungslosigkeit und existenziellen Fragen, die für die Barockzeit charakteristisch waren, insbesondere vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges.
Vocabulary Vanitas - lateinisch für "Eitelkeit" oder "Nichtigkeit", ein in der Barockzeit häufig verwendetes Motiv, das die Vergänglichkeit alles Irdischen thematisiert.
Die Gedichtanalyse zeigt, dass "Die Welt" von Christian Hofmann von Hofmannswaldau ein komplexes Werk ist, das zentrale Themen und Stilmittel des Barock vereint. Es lädt den Leser ein, über die Vergänglichkeit des Lebens nachzudenken und den Blick auf eine mögliche Erlösung jenseits des irdischen Daseins zu richten.
Der beste KI-Lernbegleiter speziell für Schüler, Millionen von von Lernzetteln und vieles mehr. Kostenlos.
Verfügbar bei


Das Gedicht "Die Welt" von Christian Hofmann von Hofmannswaldau ist ein bedeutendes Werk der Barocklyrik, das sich kritisch mit der Vergänglichkeit des Lebens und der Suche nach Erlösung auseinandersetzt. Es besteht aus einer einzigen Strophe mit 16 Versen und folgt einem durchgängigen Kreuzreimschema. Der Jambus dominiert als Versmaß, was dem Gedicht einen fließenden Rhythmus verleiht.
Highlight Der Titel "Die Welt" deutet bereits auf eine umfassende Betrachtung und Hinterfragung des irdischen Daseins hin.
Das lyrische Ich eröffnet das Gedicht mit zwei rhetorischen Fragen, die den vermeintlichen Glanz und die Pracht der Welt in Zweifel ziehen. Diese Technik dient dazu, den Leser von Beginn an zum Nachdenken anzuregen.
Example "Was ist die Welt und ihr berühmtes Glänzen? Was ist die Welt und ihre ganze Pracht?"
In den folgenden Versen wird eine düstere Sicht auf das Leben entfaltet. Durch die Verwendung der Anapher "Ein" in den Versen 3 bis 8 werden verschiedene negative Aspekte des Daseins aufgezählt und betont.
Vocabulary Anapher - die Wiederholung eines Wortes oder einer Wortgruppe am Anfang aufeinanderfolgender Verse oder Sätze.
Das Gedicht bedient sich zahlreicher Stilmittel, um seine Botschaft zu vermitteln. Metaphern wie "Ein schneller Blitz in schwarzgewölkter Nacht" für das kurze Leben oder "Ein Kummerdistelfeld" für die Schmerzen des Daseins verdeutlichen die pessimistische Weltsicht des lyrischen Ichs.
Definition Metapher - ein sprachliches Bild, bei dem ein Wort oder eine Wortgruppe aus seinem eigentlichen Bedeutungszusammenhang in einen anderen übertragen wird.
Der beste KI-Lernbegleiter speziell für Schüler, Millionen von von Lernzetteln und vieles mehr. Kostenlos.
Verfügbar bei

Unser KI-Begleiter ist speziell auf die Bedürfnisse von Schülern zugeschnitten. Basierend auf den Millionen von Inhalten, die wir auf der Plattform haben, können wir den Schülern wirklich sinnvolle und relevante Antworten geben. Aber es geht nicht nur um Antworten, sondern der Begleiter führt die Schüler auch durch ihre täglichen Lernherausforderungen, mit personalisierten Lernplänen, Quizfragen oder Inhalten im Chat und einer 100% Personalisierung basierend auf den Fähigkeiten und Entwicklungen der Schüler.
Du kannst dir die App im Google Play Store und im Apple App Store herunterladen.
Ja, du hast kostenlosen Zugriff auf Inhalte in der App und auf unseren KI-Begleiter. Zum Freischalten bestimmter Features in der App kannst du Knowunity Pro erwerben.
336

Hol dir die App, um Zugang zu den smarten Tools mit interaktiven Karteikarten, Übungsaufgaben, Probeklausuren und Zusammenfassungen zu bekommen
Diese Analyse behandelt das Gedicht 'Entdeckung an einer jungen Frau' von Bertolt Brecht und vergleicht es mit 'Vergänglichkeit der Schönheit' von Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau. Die Formanalyse umfasst Reimschema, Versmaß und Stilmittel, während die Inhaltsangabe die zentralen Themen wie Altern und den carpe diem Gedanken beleuchtet. Ideal für Studierende der Literaturwissenschaft, die sich mit der Ephemerität der Schönheit und den Unterschieden zwischen Barock und Moderne auseinandersetzen möchten.
Diese Gedichtsinterpretation analysiert Andreas Gryphius' Werk 'Es ist alles eitel', das zentrale Barockmotiv der Vergänglichkeit thematisiert. Der Text beleuchtet die Hilflosigkeit des Menschen gegenüber der Zeit und die Zerstörung durch den 30-jährigen Krieg. Wichtige Stilmittel wie Antithesen, Anaphern und Metaphern werden erläutert, um die tiefere Bedeutung des Gedichts zu erfassen. Ideal für Studierende der Literaturwissenschaft und Barockliteratur.
Entdecke die tiefgreifende Symbolik der blauen Blume in der Romantik. Diese Zusammenfassung behandelt ihre Bedeutung in der Literatur, insbesondere in Werken von Novalis und Michael Ende, sowie ihre kulturellen und emotionalen Assoziationen. Ideal für Studierende der deutschen Literatur und Kulturwissenschaften.
Detaillierte Analyse des Gedichts 'Tränen des Vaterlandes' von Andreas Gryphius. Erforschen Sie die Themen momento mori und Vanitas, die Darstellung des Krieges und die kritische Reflexion über die menschliche Existenz in der Barockepoche. Ideal für Studierende der Literaturwissenschaft.
Diese Gedichtsanalyse untersucht Sophie Mereaus Werk 'Im sonnigen Schimmer' (1800), das die Themen Liebe, Verlust und die Verbindung zwischen Mensch und Natur behandelt. Die Analyse beleuchtet das Reimschema, den Jambus, die Verwendung von Adjektiven und Verniedlichungen sowie die dramatische Klimax. Entdecken Sie, wie die romantische Stimmung im Gedicht durch die Natur und die Beziehung des lyrischen Ichs geprägt wird. Ideal für Studierende der romantischen Lyrik und Literaturwissenschaft.
Entdecken Sie die tiefgründige Analyse von Andreas Gryphius' Sonett 'Abend', das die Themen Vanitas und Memento mori behandelt. Diese Gedichtinterpretation beleuchtet die antithetische Struktur, die Metaphern und die emotionale Tiefe des lyrischen Ichs im Kontext des Barock. Ideal für Studierende der Literaturwissenschaft.
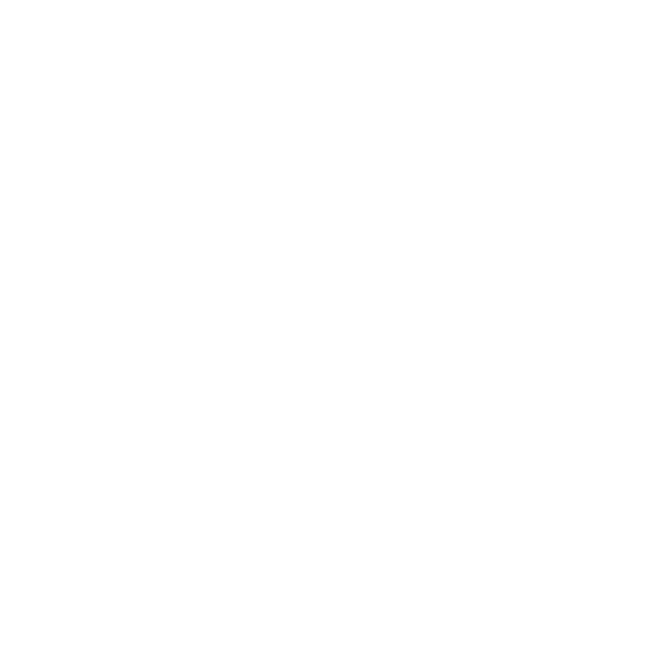
App Store
Google Play
Die App ist sehr leicht und gut gestaltet. Habe bis jetzt alles gefunden, nachdem ich gesucht habe und aus den Präsentationen echt viel lernen können! Die App werde ich auf jeden Fall für eine Klassenarbeit verwenden! Und als eigene Inspiration hilft sie natürlich auch sehr.
Stefan S
iOS user
Diese App ist wirklich echt super. Es gibt so viele Lernzettel und Hilfen, […]. Mein Problemfach ist zum Beispiel Französisch und die App hat mega viel Auswahl für Hilfe. Dank dieser App habe ich mich in Französisch verbessert. Ich würde diese jedem weiterempfehlen.
Samantha Klich
Android user
Wow ich bin wirklich komplett baff. Habe die App nur mal so ausprobiert, weil ich es schon oft in der Werbung gesehen habe und war absolut geschockt. Diese App ist DIE HILFE, die man sich für die Schule wünscht und vor allem werden so viele Sachen angeboten, wie z.B. Ausarbeitungen und Merkblätter, welche mir persönlich SEHR weitergeholfen haben.
Anna
iOS user
Ich finde Knowunity so grandios. Ich lerne wirklich für alles damit. Es gibt so viele verschiedene Lernzettel, die sehr gut erklärt sind!
Jana V
iOS user
Ich liebe diese App sie hilft mir vor jeder Arbeit kann Aufgaben kontrollieren sowie lösen und ist wirklich vielfältig verwendbar. Man kann mit diesem Fuchs auch normal reden so wie Probleme im echten Leben besprechen und er hilft einem. Wirklich sehr gut diese App kann ich nur weiter empfehlen, gerade für Menschen die etwas länger brauchen etwas zu verstehen!
Lena M
Android user
Ich finde Knowunity ist eine super App. Für die Schule ist sie ideal , wegen den Lernzetteln, Quizen und dem AI. Das gute an AI ist , dass er nicht direkt nur die Lösung ausspuckt sondern einen Weg zeigt wie man darauf kommt. Manchmal gibt er einem auch nur einen Tipp damit man selbst darauf kommt . Mir hilft Knowunity persönlich sehr viel und ich kann sie nur weiterempfehlen ☺️
Timo S
iOS user
Die App ist einfach super! Ich muss nur in die Suchleiste mein Thema eintragen und ich checke es sehr schnell. Ich muss nicht mehr 10 YouTube Videos gucken, um etwas zu verstehen und somit spare ich mir meine Zeit. Einfach zu empfehlen!!
Sudenaz Ocak
Android user
Diese App hat mich echt verbessert! In der Schule war ich richtig schlecht in Mathe und dank der App kann ich besser Mathe! Ich bin so dankbar, dass ihr die App gemacht habt.
Greenlight Bonnie
Android user
Ich benutze Knowunity schon sehr lange und meine Noten haben sich verbessert die App hilft mir bei Mathe,Englisch u.s.w. Ich bekomme Hilfe wenn ich sie brauche und bekomme sogar Glückwünsche für meine Arbeit Deswegen von mir 5 Sterne🫶🏼
Julia S
Android user
Also die App hat mir echt in super vielen Fächern geholfen! Ich hatte in der Mathe Arbeit davor eine 3+ und habe nur durch den School GPT und die Lernzettek auf der App eine 1-3 in Mathe geschafft…Ich bin Mega glücklich darüber also ja wircklich eine super App zum lernen und es spart sehr viel Heit dass man mehr Freizeit hat!
Marcus B
iOS user
Mit dieser App hab ich bessere Noten bekommen. Bessere Lernzettel gekriegt. Ich habe die App benutzt, als ich die Fächer nicht ganz verstanden habe,diese App ist ein würcklich GameChanger für die Schule, Hausaufgaben
Sarah L
Android user
Hatte noch nie so viel Spaß beim Lernen und der School Bot macht super Aufschriebe die man Herunterladen kann total Übersichtlich und Lehreich. Bin begeistert.
Hans T
iOS user
Die App ist sehr leicht und gut gestaltet. Habe bis jetzt alles gefunden, nachdem ich gesucht habe und aus den Präsentationen echt viel lernen können! Die App werde ich auf jeden Fall für eine Klassenarbeit verwenden! Und als eigene Inspiration hilft sie natürlich auch sehr.
Stefan S
iOS user
Diese App ist wirklich echt super. Es gibt so viele Lernzettel und Hilfen, […]. Mein Problemfach ist zum Beispiel Französisch und die App hat mega viel Auswahl für Hilfe. Dank dieser App habe ich mich in Französisch verbessert. Ich würde diese jedem weiterempfehlen.
Samantha Klich
Android user
Wow ich bin wirklich komplett baff. Habe die App nur mal so ausprobiert, weil ich es schon oft in der Werbung gesehen habe und war absolut geschockt. Diese App ist DIE HILFE, die man sich für die Schule wünscht und vor allem werden so viele Sachen angeboten, wie z.B. Ausarbeitungen und Merkblätter, welche mir persönlich SEHR weitergeholfen haben.
Anna
iOS user
Ich finde Knowunity so grandios. Ich lerne wirklich für alles damit. Es gibt so viele verschiedene Lernzettel, die sehr gut erklärt sind!
Jana V
iOS user
Ich liebe diese App sie hilft mir vor jeder Arbeit kann Aufgaben kontrollieren sowie lösen und ist wirklich vielfältig verwendbar. Man kann mit diesem Fuchs auch normal reden so wie Probleme im echten Leben besprechen und er hilft einem. Wirklich sehr gut diese App kann ich nur weiter empfehlen, gerade für Menschen die etwas länger brauchen etwas zu verstehen!
Lena M
Android user
Ich finde Knowunity ist eine super App. Für die Schule ist sie ideal , wegen den Lernzetteln, Quizen und dem AI. Das gute an AI ist , dass er nicht direkt nur die Lösung ausspuckt sondern einen Weg zeigt wie man darauf kommt. Manchmal gibt er einem auch nur einen Tipp damit man selbst darauf kommt . Mir hilft Knowunity persönlich sehr viel und ich kann sie nur weiterempfehlen ☺️
Timo S
iOS user
Die App ist einfach super! Ich muss nur in die Suchleiste mein Thema eintragen und ich checke es sehr schnell. Ich muss nicht mehr 10 YouTube Videos gucken, um etwas zu verstehen und somit spare ich mir meine Zeit. Einfach zu empfehlen!!
Sudenaz Ocak
Android user
Diese App hat mich echt verbessert! In der Schule war ich richtig schlecht in Mathe und dank der App kann ich besser Mathe! Ich bin so dankbar, dass ihr die App gemacht habt.
Greenlight Bonnie
Android user
Ich benutze Knowunity schon sehr lange und meine Noten haben sich verbessert die App hilft mir bei Mathe,Englisch u.s.w. Ich bekomme Hilfe wenn ich sie brauche und bekomme sogar Glückwünsche für meine Arbeit Deswegen von mir 5 Sterne🫶🏼
Julia S
Android user
Also die App hat mir echt in super vielen Fächern geholfen! Ich hatte in der Mathe Arbeit davor eine 3+ und habe nur durch den School GPT und die Lernzettek auf der App eine 1-3 in Mathe geschafft…Ich bin Mega glücklich darüber also ja wircklich eine super App zum lernen und es spart sehr viel Heit dass man mehr Freizeit hat!
Marcus B
iOS user
Mit dieser App hab ich bessere Noten bekommen. Bessere Lernzettel gekriegt. Ich habe die App benutzt, als ich die Fächer nicht ganz verstanden habe,diese App ist ein würcklich GameChanger für die Schule, Hausaufgaben
Sarah L
Android user
Hatte noch nie so viel Spaß beim Lernen und der School Bot macht super Aufschriebe die man Herunterladen kann total Übersichtlich und Lehreich. Bin begeistert.
Hans T
iOS user
Deutsch
17. Sept. 2025
10.176
2 Seiten
Jule :) @lernen.leichtgemacht
Die Welt von Christian Hofmann von Hofmannswaldau: Eine barocke Reflexion über Vergänglichkeit und Erlösung
Das Gedicht "Die Welt" von Christian Hofmann von Hofmannswaldauist ein tiefgründiges Werk der... Mehr anzeigen

Trotz der vorherrschenden negativen Sichtweise auf das irdische Leben enthält das Gedicht auch einen Aufruf zur geistigen Erweiterung. Das lyrische Ich fordert die Seele auf, über die Grenzen der bekannten Welt hinauszublicken
Quote "Komm Seele, komm und lerne weiter schauen / Als sich der Zirkel dieser Welt erstreckt"
Diese Aufforderung steht im Kontrast zum vorherigen Jambus und wird dadurch besonders hervorgehoben. Sie suggeriert, dass es jenseits der irdischen Beschränkungen eine tiefere Erkenntnis oder Erlösung geben könnte.
Das Gedicht gipfelt in der Vorstellung des Todes als Befreiung von den Lasten des Lebens. Der Hafen der Ewigkeit wird als Metapher für das Leben nach dem Tod verwendet, wobei die Schönheit erst in der Unendlichkeit vollständig erkannt werden kann.
Highlight Die Darstellung des Todes als Erlösung ist ein typisches Motiv der Barockliteratur und spiegelt die Vanitas-Thematik wider.
Das gesamte Gedicht kann als eine Antithese betrachtet werden, die die irdische Welt dem menschlichen Streben nach Transzendenz gegenüberstellt. Es reflektiert die Orientierungslosigkeit und existenziellen Fragen, die für die Barockzeit charakteristisch waren, insbesondere vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges.
Vocabulary Vanitas - lateinisch für "Eitelkeit" oder "Nichtigkeit", ein in der Barockzeit häufig verwendetes Motiv, das die Vergänglichkeit alles Irdischen thematisiert.
Die Gedichtanalyse zeigt, dass "Die Welt" von Christian Hofmann von Hofmannswaldau ein komplexes Werk ist, das zentrale Themen und Stilmittel des Barock vereint. Es lädt den Leser ein, über die Vergänglichkeit des Lebens nachzudenken und den Blick auf eine mögliche Erlösung jenseits des irdischen Daseins zu richten.
Der beste KI-Lernbegleiter speziell für Schüler, Millionen von von Lernzetteln und vieles mehr. Kostenlos.
Verfügbar bei


Das Gedicht "Die Welt" von Christian Hofmann von Hofmannswaldau ist ein bedeutendes Werk der Barocklyrik, das sich kritisch mit der Vergänglichkeit des Lebens und der Suche nach Erlösung auseinandersetzt. Es besteht aus einer einzigen Strophe mit 16 Versen und folgt einem durchgängigen Kreuzreimschema. Der Jambus dominiert als Versmaß, was dem Gedicht einen fließenden Rhythmus verleiht.
Highlight Der Titel "Die Welt" deutet bereits auf eine umfassende Betrachtung und Hinterfragung des irdischen Daseins hin.
Das lyrische Ich eröffnet das Gedicht mit zwei rhetorischen Fragen, die den vermeintlichen Glanz und die Pracht der Welt in Zweifel ziehen. Diese Technik dient dazu, den Leser von Beginn an zum Nachdenken anzuregen.
Example "Was ist die Welt und ihr berühmtes Glänzen? Was ist die Welt und ihre ganze Pracht?"
In den folgenden Versen wird eine düstere Sicht auf das Leben entfaltet. Durch die Verwendung der Anapher "Ein" in den Versen 3 bis 8 werden verschiedene negative Aspekte des Daseins aufgezählt und betont.
Vocabulary Anapher - die Wiederholung eines Wortes oder einer Wortgruppe am Anfang aufeinanderfolgender Verse oder Sätze.
Das Gedicht bedient sich zahlreicher Stilmittel, um seine Botschaft zu vermitteln. Metaphern wie "Ein schneller Blitz in schwarzgewölkter Nacht" für das kurze Leben oder "Ein Kummerdistelfeld" für die Schmerzen des Daseins verdeutlichen die pessimistische Weltsicht des lyrischen Ichs.
Definition Metapher - ein sprachliches Bild, bei dem ein Wort oder eine Wortgruppe aus seinem eigentlichen Bedeutungszusammenhang in einen anderen übertragen wird.
Der beste KI-Lernbegleiter speziell für Schüler, Millionen von von Lernzetteln und vieles mehr. Kostenlos.
Verfügbar bei

Unser KI-Begleiter ist speziell auf die Bedürfnisse von Schülern zugeschnitten. Basierend auf den Millionen von Inhalten, die wir auf der Plattform haben, können wir den Schülern wirklich sinnvolle und relevante Antworten geben. Aber es geht nicht nur um Antworten, sondern der Begleiter führt die Schüler auch durch ihre täglichen Lernherausforderungen, mit personalisierten Lernplänen, Quizfragen oder Inhalten im Chat und einer 100% Personalisierung basierend auf den Fähigkeiten und Entwicklungen der Schüler.
Du kannst dir die App im Google Play Store und im Apple App Store herunterladen.
Ja, du hast kostenlosen Zugriff auf Inhalte in der App und auf unseren KI-Begleiter. Zum Freischalten bestimmter Features in der App kannst du Knowunity Pro erwerben.
336

Hol dir die App, um Zugang zu den smarten Tools mit interaktiven Karteikarten, Übungsaufgaben, Probeklausuren und Zusammenfassungen zu bekommen
Diese Analyse behandelt das Gedicht 'Entdeckung an einer jungen Frau' von Bertolt Brecht und vergleicht es mit 'Vergänglichkeit der Schönheit' von Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau. Die Formanalyse umfasst Reimschema, Versmaß und Stilmittel, während die Inhaltsangabe die zentralen Themen wie Altern und den carpe diem Gedanken beleuchtet. Ideal für Studierende der Literaturwissenschaft, die sich mit der Ephemerität der Schönheit und den Unterschieden zwischen Barock und Moderne auseinandersetzen möchten.
Diese Gedichtsinterpretation analysiert Andreas Gryphius' Werk 'Es ist alles eitel', das zentrale Barockmotiv der Vergänglichkeit thematisiert. Der Text beleuchtet die Hilflosigkeit des Menschen gegenüber der Zeit und die Zerstörung durch den 30-jährigen Krieg. Wichtige Stilmittel wie Antithesen, Anaphern und Metaphern werden erläutert, um die tiefere Bedeutung des Gedichts zu erfassen. Ideal für Studierende der Literaturwissenschaft und Barockliteratur.
Entdecke die tiefgreifende Symbolik der blauen Blume in der Romantik. Diese Zusammenfassung behandelt ihre Bedeutung in der Literatur, insbesondere in Werken von Novalis und Michael Ende, sowie ihre kulturellen und emotionalen Assoziationen. Ideal für Studierende der deutschen Literatur und Kulturwissenschaften.
Detaillierte Analyse des Gedichts 'Tränen des Vaterlandes' von Andreas Gryphius. Erforschen Sie die Themen momento mori und Vanitas, die Darstellung des Krieges und die kritische Reflexion über die menschliche Existenz in der Barockepoche. Ideal für Studierende der Literaturwissenschaft.
Diese Gedichtsanalyse untersucht Sophie Mereaus Werk 'Im sonnigen Schimmer' (1800), das die Themen Liebe, Verlust und die Verbindung zwischen Mensch und Natur behandelt. Die Analyse beleuchtet das Reimschema, den Jambus, die Verwendung von Adjektiven und Verniedlichungen sowie die dramatische Klimax. Entdecken Sie, wie die romantische Stimmung im Gedicht durch die Natur und die Beziehung des lyrischen Ichs geprägt wird. Ideal für Studierende der romantischen Lyrik und Literaturwissenschaft.
Entdecken Sie die tiefgründige Analyse von Andreas Gryphius' Sonett 'Abend', das die Themen Vanitas und Memento mori behandelt. Diese Gedichtinterpretation beleuchtet die antithetische Struktur, die Metaphern und die emotionale Tiefe des lyrischen Ichs im Kontext des Barock. Ideal für Studierende der Literaturwissenschaft.
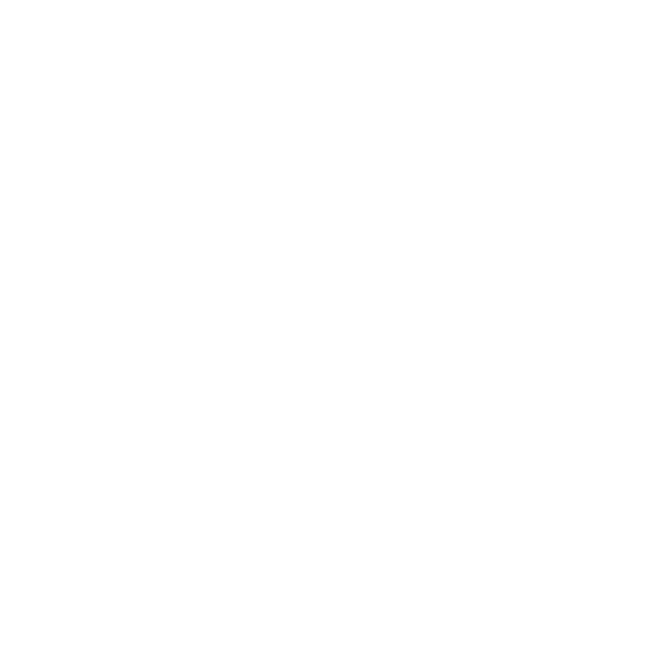
App Store
Google Play
Die App ist sehr leicht und gut gestaltet. Habe bis jetzt alles gefunden, nachdem ich gesucht habe und aus den Präsentationen echt viel lernen können! Die App werde ich auf jeden Fall für eine Klassenarbeit verwenden! Und als eigene Inspiration hilft sie natürlich auch sehr.
Stefan S
iOS user
Diese App ist wirklich echt super. Es gibt so viele Lernzettel und Hilfen, […]. Mein Problemfach ist zum Beispiel Französisch und die App hat mega viel Auswahl für Hilfe. Dank dieser App habe ich mich in Französisch verbessert. Ich würde diese jedem weiterempfehlen.
Samantha Klich
Android user
Wow ich bin wirklich komplett baff. Habe die App nur mal so ausprobiert, weil ich es schon oft in der Werbung gesehen habe und war absolut geschockt. Diese App ist DIE HILFE, die man sich für die Schule wünscht und vor allem werden so viele Sachen angeboten, wie z.B. Ausarbeitungen und Merkblätter, welche mir persönlich SEHR weitergeholfen haben.
Anna
iOS user
Ich finde Knowunity so grandios. Ich lerne wirklich für alles damit. Es gibt so viele verschiedene Lernzettel, die sehr gut erklärt sind!
Jana V
iOS user
Ich liebe diese App sie hilft mir vor jeder Arbeit kann Aufgaben kontrollieren sowie lösen und ist wirklich vielfältig verwendbar. Man kann mit diesem Fuchs auch normal reden so wie Probleme im echten Leben besprechen und er hilft einem. Wirklich sehr gut diese App kann ich nur weiter empfehlen, gerade für Menschen die etwas länger brauchen etwas zu verstehen!
Lena M
Android user
Ich finde Knowunity ist eine super App. Für die Schule ist sie ideal , wegen den Lernzetteln, Quizen und dem AI. Das gute an AI ist , dass er nicht direkt nur die Lösung ausspuckt sondern einen Weg zeigt wie man darauf kommt. Manchmal gibt er einem auch nur einen Tipp damit man selbst darauf kommt . Mir hilft Knowunity persönlich sehr viel und ich kann sie nur weiterempfehlen ☺️
Timo S
iOS user
Die App ist einfach super! Ich muss nur in die Suchleiste mein Thema eintragen und ich checke es sehr schnell. Ich muss nicht mehr 10 YouTube Videos gucken, um etwas zu verstehen und somit spare ich mir meine Zeit. Einfach zu empfehlen!!
Sudenaz Ocak
Android user
Diese App hat mich echt verbessert! In der Schule war ich richtig schlecht in Mathe und dank der App kann ich besser Mathe! Ich bin so dankbar, dass ihr die App gemacht habt.
Greenlight Bonnie
Android user
Ich benutze Knowunity schon sehr lange und meine Noten haben sich verbessert die App hilft mir bei Mathe,Englisch u.s.w. Ich bekomme Hilfe wenn ich sie brauche und bekomme sogar Glückwünsche für meine Arbeit Deswegen von mir 5 Sterne🫶🏼
Julia S
Android user
Also die App hat mir echt in super vielen Fächern geholfen! Ich hatte in der Mathe Arbeit davor eine 3+ und habe nur durch den School GPT und die Lernzettek auf der App eine 1-3 in Mathe geschafft…Ich bin Mega glücklich darüber also ja wircklich eine super App zum lernen und es spart sehr viel Heit dass man mehr Freizeit hat!
Marcus B
iOS user
Mit dieser App hab ich bessere Noten bekommen. Bessere Lernzettel gekriegt. Ich habe die App benutzt, als ich die Fächer nicht ganz verstanden habe,diese App ist ein würcklich GameChanger für die Schule, Hausaufgaben
Sarah L
Android user
Hatte noch nie so viel Spaß beim Lernen und der School Bot macht super Aufschriebe die man Herunterladen kann total Übersichtlich und Lehreich. Bin begeistert.
Hans T
iOS user
Die App ist sehr leicht und gut gestaltet. Habe bis jetzt alles gefunden, nachdem ich gesucht habe und aus den Präsentationen echt viel lernen können! Die App werde ich auf jeden Fall für eine Klassenarbeit verwenden! Und als eigene Inspiration hilft sie natürlich auch sehr.
Stefan S
iOS user
Diese App ist wirklich echt super. Es gibt so viele Lernzettel und Hilfen, […]. Mein Problemfach ist zum Beispiel Französisch und die App hat mega viel Auswahl für Hilfe. Dank dieser App habe ich mich in Französisch verbessert. Ich würde diese jedem weiterempfehlen.
Samantha Klich
Android user
Wow ich bin wirklich komplett baff. Habe die App nur mal so ausprobiert, weil ich es schon oft in der Werbung gesehen habe und war absolut geschockt. Diese App ist DIE HILFE, die man sich für die Schule wünscht und vor allem werden so viele Sachen angeboten, wie z.B. Ausarbeitungen und Merkblätter, welche mir persönlich SEHR weitergeholfen haben.
Anna
iOS user
Ich finde Knowunity so grandios. Ich lerne wirklich für alles damit. Es gibt so viele verschiedene Lernzettel, die sehr gut erklärt sind!
Jana V
iOS user
Ich liebe diese App sie hilft mir vor jeder Arbeit kann Aufgaben kontrollieren sowie lösen und ist wirklich vielfältig verwendbar. Man kann mit diesem Fuchs auch normal reden so wie Probleme im echten Leben besprechen und er hilft einem. Wirklich sehr gut diese App kann ich nur weiter empfehlen, gerade für Menschen die etwas länger brauchen etwas zu verstehen!
Lena M
Android user
Ich finde Knowunity ist eine super App. Für die Schule ist sie ideal , wegen den Lernzetteln, Quizen und dem AI. Das gute an AI ist , dass er nicht direkt nur die Lösung ausspuckt sondern einen Weg zeigt wie man darauf kommt. Manchmal gibt er einem auch nur einen Tipp damit man selbst darauf kommt . Mir hilft Knowunity persönlich sehr viel und ich kann sie nur weiterempfehlen ☺️
Timo S
iOS user
Die App ist einfach super! Ich muss nur in die Suchleiste mein Thema eintragen und ich checke es sehr schnell. Ich muss nicht mehr 10 YouTube Videos gucken, um etwas zu verstehen und somit spare ich mir meine Zeit. Einfach zu empfehlen!!
Sudenaz Ocak
Android user
Diese App hat mich echt verbessert! In der Schule war ich richtig schlecht in Mathe und dank der App kann ich besser Mathe! Ich bin so dankbar, dass ihr die App gemacht habt.
Greenlight Bonnie
Android user
Ich benutze Knowunity schon sehr lange und meine Noten haben sich verbessert die App hilft mir bei Mathe,Englisch u.s.w. Ich bekomme Hilfe wenn ich sie brauche und bekomme sogar Glückwünsche für meine Arbeit Deswegen von mir 5 Sterne🫶🏼
Julia S
Android user
Also die App hat mir echt in super vielen Fächern geholfen! Ich hatte in der Mathe Arbeit davor eine 3+ und habe nur durch den School GPT und die Lernzettek auf der App eine 1-3 in Mathe geschafft…Ich bin Mega glücklich darüber also ja wircklich eine super App zum lernen und es spart sehr viel Heit dass man mehr Freizeit hat!
Marcus B
iOS user
Mit dieser App hab ich bessere Noten bekommen. Bessere Lernzettel gekriegt. Ich habe die App benutzt, als ich die Fächer nicht ganz verstanden habe,diese App ist ein würcklich GameChanger für die Schule, Hausaufgaben
Sarah L
Android user
Hatte noch nie so viel Spaß beim Lernen und der School Bot macht super Aufschriebe die man Herunterladen kann total Übersichtlich und Lehreich. Bin begeistert.
Hans T
iOS user